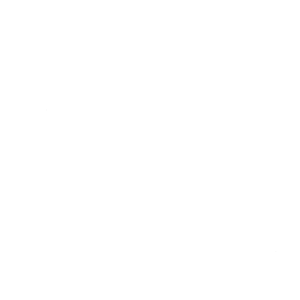Dr. Hans Klein:*)
Walther Hensel und der Finkensteiner Bund
Professor Dr. Hauffen, der Inhaber der Lehrkanzel für Volkskunde an der Deutschen Universität Prag, hielt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in den Versammlungen des Deutschen Sprachvereins, dessen Vorsitzender er war, regelmäßig Vorträge aus seinem Fachgebiet. An einem solchen Vortragsabend erläuterte er seine Ausführungen durch Musikbeispiele, indem er charakteristische Weihnachtslieder aus dem Böhmerwald vortragen ließ. Er hatte zu diesem Zweck die seiner Familie befreundete Prager Konzertsängerin Olga Pokorny mit dem Germanisten und Volksliedforscher Dr. Julius Janiczek bekannt gemacht, der sie auf der Laute begleiten sollte. Diese erste musikalische Begegnung bedeutete für diese beiden eine Wende ihrer Lebenswege.
Julius Janiczek (geb. 1887), der später unter dem Namen Walther Hensel als Musikerzieher, Volksliederneuerer und Begründer der Finkensteiner Singbewegung einen gesamtdeutschen, ja europäischen Ruf gewann, war 1911 aus Freiburg in der Schweiz, wo er bei Prof. Dr. Primus Lessiak mit einer Dissertation über den Vokalismus der Schönhengster, seiner heimatlichen Mundart, den Doktorgrad erworben hatte, nach Prag zurückgekehrt und wirkte damals als Lehrer für neuere Sprachen an der dortigen Deutschen Handelsakademie. Neben seinem germanistischen und romanistischen Fachstudium hatten ihn aber in Freiburg aufs stärkste die Vorlesungen und Übungen des berühmten Choralisten Peter Wagner über mittelalterliche Musik beschäftigt. Aus einer seit Generationen musikalisch interessierten und Musik treibenden Mährisch-Trübauer Familie stammend, hatte er schon in seinen ersten Semestern in Wien bei Professor Grädener Harmonielehre und Kontrapunkt studiert. Das entscheidende Erlebnis jener Jahre vor dem Ersten Weltkrieg aber war in positivem wie in negativem Sinne der „Zupfgeigenhansl“ Hans Breuers, der nach Herders und der Romantiker literarischer Volksliedentdeckung und nach Uhlands wissenschaftlicher Volksliedforschung die dritte Volkslied-Renaissance einleitete: die Wiedergeburt des Volksliedsingens als leben- und gemeinschaftsformendes Tun.
Breuer hatte seinen Wandervögeln den Weg vom heutigen Gebrauchslied – auf Fahrt, in der Herberge, beim Lagerfeuer – zum künstlerisch wertvollen Volkslied gewiesen und die kostbarsten Schätze aus der Zeit seiner Hochblüte, vor allem aus dem 16. Jahrhundert, zum erstenmal wieder zum Klingen gebracht – nicht auf Konzertpodien vor passiven Hörern, sondern im Kreis junger, von einem neuen Lebensgefühl erfüllter Menschen: das war sein unbestreitbares Verdienst; daß er seine Freunde aber nur zu den linearen alten Weisen, nicht aber zu den ihnen wesensgemäßen polyphonen Sätzen führte, sondern sich mit akkordischer Gitarrenbegleitung begnügte, das war seine zeitbedingte Unvollkommenheit, an deren Überwindung ihn sein früher Tod im Ersten Weltkrieg hinderte.
Daß das Volkslied-Erlebnis jener Jahre für Hensel lebensbestimmend wurde, hatte zwei Gründe.
Erstens stammte er selbst aus einer Familie von „Volksliedträgern“. Waren sein Vater und dessen südmährische Vorfahren seit altersher tüchtige Instrumentalisten, so hütete die Mutter einen reichen Schatz aus ihrem Elternhaus ererbter Lieder in ihrem treuen Gedächtnis und war ihrem Sohn die erste Quelle, als dieser im Trübauer Gymnasium von seinem Deutschlehrer Dr. Spina angeregt worden war, im volkskundlich so ergiebigen heimatlichen Schönhengstgau auf Volksliedersuche zu gehen. In Wien war er mit dem Kreis um den großen alpenländischen Volksliedersammler Josef Pommer in persönliche Fühlung gekommen, und auch sein Freiburger Lehrer Dr. Lessiak gehörte diesem Kreise an. Durch Lessiaks Vermittlung unternahm Hensel 1912 und 1913 im Auftrag der Staatlichen Österreichischen Volksliedkommission zwei Sammelfahrten nach Kärnten, von denen er eine reiche Ernte heimbrachte.
Doch schon die Frucht dieser beiden Fahrten: die zwei Hefte „Deutsche Liedlein aus Österreich“ (1913 und 1917 bei Hofmeister in Leipzig erschienen) zeigt den zweiten Aspekt seiner Einstellung zum Volkslied. Das bloße Sammeln, das in immer größerem Umfang und immer strafferer Zentralisierung zu dem imposanten Freiburger Volksliederarchiv John Meiers führte, genügte weder der künstlerischen noch der volksbildnerischen Seite seines Wesens. Ihm war es um mehr zu tun als um eine museale Konservierung des kostbaren Volksgutes und um eine musikwissenschaftliche Erforschung. „Gebt dem Volk sein Lied wieder, das entschwindende, und ihr gebt ihm seine Seele wieder!“ Dieses Wort Roseggers deutet die Richtung seines Wollens an, das ihn schon vor dem Ersten Weltkrieg angesichts der Entseelung weitester Volksschichten erfüllte, das ihm aber nach dem Zusammenbruch Österreichs und der zwangsweisen Eingliederung der Deutschen Böhmens, Mährens und Schlesiens in einen slawischen Nationalstaat zur volksbildnerischen Pflicht wurde.
Das verstummte sudetendeutsche Volk zum Singen und damit zum Bewusstwerden seiner geistigen Substanz zu erwecken, das war fortan sein Leitgedanke.
Damals schloß er den Ehebund mit Olga Pokorny und trat aus dem Schuldienst aus, um sich mit seiner Gattin, die ihre Gesangstudien in Prag, Wien und Leipzig absolviert und in Prag seinerzeit die ersten Jugendkonzerte veranstaltet hatte, ganz dem neuen Lebensziel zu widmen. Walther und Olga Hensel begannen mit gemeinsamen Liederabenden, in denen alte und neue Volkslieder im Einzel- und Zwiegesang zur Laute erklangen – planmäßig bereiste man die sudetendeutschen Landschaften, und bald erfolgten Einladungen ins Ausland. Aber so herzlichen Beifall und Dank diese Abende auch überall fanden, sie bewirkten doch nicht das, was mit ihnen bezweckt war: ein neu anhebendes Singen im Volke selbst.
Es waren die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, als die alten österreichischen Kulturorganisationen zerfallen waren und ihr neuer Aufbau in den Sudetenländern den neuen staatlichen Gegebenheiten angepaßt werden mußte. In zahllosen Tagungen berieten geistige Arbeiter die neuen Aufgaben. Der Gedanke, nach dem Verlust unseres politischen Einflusses nunmehr den geistigen Grundlagen unseres Volkstums erhöhte Aufmerksamkeit und Pflege zuzuwenden, erfüllte vor allem den „Böhmerland“-Kreis: einen Kreis von Volksbildnern, die für eine Vertiefung der Heimatbildung eintraten, für die Erhaltung wertvollen Brauchtums und alter Sitte, für eine geistige Weiterführung der schulentwachsenen Jugend nach dem Vorbild der nordischen Volkshochschulen u. a. – mit einem Wort: die den Verlust an politischer Macht durch eine verstärkte Pflege der kulturellen Güter wettmachen wollten, um unser Volk auch unter den neuen schwierigen Verhältnissen gesund und produktiv zu erhalten. Vorträge und Diskussionen erfüllten diese Tagungen, die als „Böhmerland-Wochen“ Volkserzieher aller politischen Richtungen in der gemeinsamen Sorge vereinten, und da sie von zahlreichen der Jugendbewegung entwachsenen Menschen besucht und mitgeprägt wurden, erklang auch bald das gemeinsame Lied am Morgen und am Abend, dem wechselnden Tagesinhalt einen festen Rahmen gebend und den in Redekämpfen und Meinungsstreiten entzweiten Gemütern mit einem Schlage ihre Gemeinsamkeit zum Bewußtsein bringend. Walther Hensel gab diesem Singen mit immer neuen Liedern und immer anspruchsvollerer Mehrstimmigkeit stetig neuen Stoff. Die künstlerisch dem Stil der jeweiligen Melodien entsprechenden Sätze erforderten eine neue Einstellung zum Chorsingen -, die Probleme homophoner und polyphoner Satzweise, linearer oder aus der Kadenz abgeleiteter Melodik, instrumental begleiteten oder reinen a-cappella-Gesanges, ebenso die Einsicht, daß ein reiner, einheitlicher Chorklang nur aus gründlicher Stimmschulung erwachsen könne: all das brachte die Stimmbildnerin Olga Hensel auf den Gedanken, einmal einen Lehrgang nach Art der Böhmerlandwochen allein dem Singen zu widmen, nur in umgekehrter Form: die praktische musikalische Arbeit sollte den Hauptanteil ausmachen, die Erörterung theoretischer Fragen in die nötigen Pausen verlegt werden. Und so kam es im Sommer 1923 zur ersten Singwoche in Finkenstein bei Mährisch Trübau, die ihren 80 Teilnehmern zu einem unvergeßlichen Erlebnis und zu einem richtungweisenden Impuls wurde.
Aus unseren sudetendeutschen Sorgen und Nöten war sie erwachsen. Daß sie aber eine fast unübersehbare gesamtdeutsche und europäische Nachfolge finden sollte, das ahnten wir damals nicht.
Einer ihrer Teilnehmer, ein junger Augsburger Buchhändler namens Karl Vötterle, der eben im Begriff war, einen Verlag zu gründen, schlug Hensel eine periodische Denkschrift vor, die allmonatlich erscheinen und das Organ für Walther Hensels Liedveröffentlichungen werden sollte. So entstanden die „Finkensteiner Blätter“, die von 1923 bis 1933 erschienen und in ihrer Gesamtheit heute die innere Entwicklung der Finkensteiner Singbewegung spiegeln; sie wurden zum Grundstock des heute weltweit wirkenden Bärenreiter-Verlages in Kassel.
Ein anderer, Studienrat Richard Poppe aus Waldenburg in Schlesien, lud Hensel noch im gleichen Sommer 1923 zu einer Singwoche nach der Herrnhutersiedlung Gnadenfrei ein; dorthin hatte er zahlreiche Jugendpfleger und Erzieher aus allen Schulgattungen, geistliche und weltliche, gerufen. Die Intensität der musikerzieherischen Arbeit, in die sich Walther Hensel als Chorleiter mit Olga Hensel als Stimmbildnerin teilten, überzeugte diesen Teilnehmerkreis derart von dem volksbildnerischen Wert der Singwoche, daß von nun an Einladungen nach allen Teilen Deutschlands, ja über dessen Grenzen hinaus nach Österreich, der Schweiz, nach Holland, Dänemark und Finnland erfolgten. Um dem bis 1933 stetig steigenden Bedürfnis nachzukommen, wurden Schüler Walther Hensels zur Leitung solcher Wochen herangezogen, so vor allem Adolf Seifert (Asch) und Oskar Fitz (Wien).
Als Organisationsform dieser weitverzweigten Arbeit entstand zuerst 1924 der sudetendeutsche „Finkensteiner Bund“, ein Jahr später folgte der reichsdeutsche gleichen Namens, der 1934 der Uniformierung des Geisteslebens im „Dritten Reich“ zum Opfer fiel; der sudetendeutsche bestand bis 1938. Wichtiger und dauerhafter als diese Vereinsgründungen aber war der lebendige Zusammenhalt der ehemaligen Singwochenteilnehmer in ihren heimatlichen Singkreisen und Singgemeinden. Immer neue geistige Nahrung boten ihnen Hensels Veröffentlichungen – außer dem Liedgut der „Finkensteiner Blätter“ die theoretischen Aufsätze in der „Klingenden Saat“, einer Beilage der Zeitschrift „Lied und Volk“, seine „Musikalische Grundlehre“ und endlich das wichtigste seiner Bücher, seine „Kleine Volksliedkunde – Auf den Spuren des Volkslieds“ (sämtliche im Bärenreiter-Verlag Kassel).
Walther Hensel selbst, der sich seit 1938 infolge des veränderten geistigen Klimas in zunehmendem Maße von der Öffentlichkeit zurückzog, wurde zwar im Jahre 1941 von der Philosophischen Fakultät der Prager Deutschen Universität mit dem Eichendorff-Preis ausgezeichnet, doch hat er weder vor noch nach 1945 mehr größere musikalische Arbeiten veröffentlicht. So schmerzlich ihn, den dadurch völlig Verarmten, das Los der Vertreibung aus der Heimat getroffen hatte, so hat er doch bis zu seinem allzu frühen Tode im Jahre 1956 ununterbrochen weiter wissenschaftlich und künstlerisch gearbeitet. Schwer durchschaubare Hemmungen hielten ihn jedoch immer wieder von der Drucklegung ab, und so harrt heute ein umfangreicher schriftlicher Nachlaß der Veröffentlichung. Ein letzter Lichtblick war die Verleihung des Sudetendeutschen Kulturpreises wenige Monate vor seinem einsamen Tode.
So stark aber haben das Finkensteiner Liedgut und das neue Chorsingen die Gemeinschaft der Singenden geprägt, daß sie nach 1945, in alle Windrichtungen zerstreut, bald wieder Fühlung miteinander suchten und sich landschaftsweise zu Singtreffen vereinten. Ein solcher Kreis hat in München-Gräfelfing im Herbst 1961 die „Walther-Hensel-Gesellschaft“ gegründet, um die seit 1934, bzw. 1938 nicht mehr aufgelegten Liederbücher Hensels „Der singende Quell“, „Das Aufrecht Fähnlein“, „Wach auf: Festliche Weisen“ sowie die beiden Bände des „Finkensteiner Liederbuchs“ durch Neudruck wieder zugänglich zu machen, denn diese Bücher sind heute genau so bahnbrechend und wegweisend wie einst und haben gerade in unserer heutigen chaotischen Zeit die Aufgabe, die Menschen zu sammeln, die den Glauben an die zeugende Kraft des Volksgeistes nicht verloren haben.
„Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes, nicht ein Menschengeschenk. So vertreibt sie auch den Teufel und macht die Leute fröhlich; man vergißt dabei alles Zornes, Unkeuschheit, Hoffahrt und anderer Laster. Ich gebe nach der Theologie der Musika die nächste Stelle und höchste Ehre.“
Dr. Martin Luther
*) Aus der Zeitschrift „Sudetenland“ mit Genehmigung des Verlags.